|
|
Die Havelregulierungsbauten
in Brandenburg an der Havel
Die Schaffung des Mühlenstaus, der Bau des
Mühlendammes durch die einzelnen Havelarme bei Brandenburg
im Mittelalter, war eine Wasserbaumaßnahme mit sehr weit
reichenden Auswirkungen. Der Wasserspiegel der Oberhavel
wurde dadurch angehoben. Viele ehemals trockene Gebiete der
ohnehin sehr flachen Havelniederung vernässten oder standen
unter Wasser. Selbst mittelalterliche Siedlungen gingen in
den Fluten unter. In Zeiten mit Hochwasser war die Situation
noch prekärer, dann wirkte sich der Havelstau bis zur Stadt
Spandau aus. Auch durchgängiger Schiffverkehr war mangels
Schleusen nicht mehr möglich. Es wurde notwendig, eine
Umfahrung des Staus anzulegen; die sogenannte Flutrinne.
1315 wurde diese Flutrinne zum ersten Mal erwähnt. Sie
umrundete die Neustadt südlich in weitem Bogen, um dem Stau
nicht zu viel Wasser zu entziehen. Östlich der Neustadt
zweigte dieser künstliche Wasserlauf von der Havel ab,
umrundete in gewundenem Lauf die Neustadt und mündete etwa
1,2 km südwestlich der Langen Brücke in die Unterhavel. Sie
hatte eine Gesamtlänge von ca. 4,5 km und ist in ihren noch
heute existierenden Abschnitten 5 bis 15 m breit und 1 bis 2
m tief. Die Flutrinne führte zum größeren Teil durch tief
liegendes Bruchland, muss aber trotzdem recht aufwändig in
ihrer Anlage gewesen sein.

Der Jakobsgraben, die ehemaligen Flutrinne, Blick von der Potsdamer Straße Richtung Güterbahnhof,
© H. M. Waßerroth
Dieser einstige Schifffahrtsweg zur
Umgehung des Mühlenstaus ist der heutige Jakobsgraben: vom Abzweig von der
Oberhavel nördlich der Potsdamer Straße, Unterquerung dieser
wie auch der Umgehungsstraße und des Güterbahnhofes (heute
beides in Rohren),
Umrundung des Schützenworths, Vereinigung mit dem
heutigen Pumpergraben und wieder Unterquerung der Eisenbahn.
Danach folgt der Jakobsgraben der heutigen
Umgehungsstraße, biegt nach Nordwest unter ihr ab und
erreicht nach etwa einem Kilometer wieder die Havel.
Der Brandenburger Markt hatte durch diese Umfahrung
allerdings einen erheblichen Nachteil, weil der
Schiffsverkehr nun so weit entfernt vorbeigeleitet wurde.
Aus diesem Grunde unternahm man bald bauliche Anstrengungen,
um den Verkehr näher an der Stadt vorbeileiten zu können.
Eine Schifffahrt wurde bereits 1384 erwähnt, vermutlich ist damit
der Stadtgraben (heute Stadtkanal) unmittelbar südlich der
Neustadt gemeint. Ab 1455 wurde die Schifffahrt ausgebaut
und eine erste Schleuse errichtet. 1548 bis 1550 entstand
unter Kurfürst Joachim I. die
Kesselschleuse für etwa 8 Finowkähne je Schleusung vor dem Steintor. Sie war seither zur
Überwindung des Mühlenstaus ununterbrochen in Betrieb. Heute
befindet sich an deren Stelle die 1925/26 erbaute und
1995/96 komplett erneuerte Stadtschleuse. Frachtkähne
werden hier aber schon lange nicht mehr geschleust. Heute
dient sie als Sportbootschleuse.
Dass der Jakobsgraben der
Frachtschifffahrt gedient hatte, lässt sich an mehreren
Stellen ausmachen, einerseits als Uferverbau zum Anlegen von
Frachtkähnen, wie auch die Ansiedlung von Betrieben zu
beiden Seiten. Heute existieren viele Betriebe allerdings
nicht mehr.

Verlag: unbekannt, Foto: unbekannt
Die Kesselschleuse auf einer
1908 gelaufenen Postkarte, Slg. H. M. Waßerroth

Verlag: unbekannt, Foto: unbekannt
Die Kesselschleuse auf einer
anderen gelaufenen Postkarte, Slg. H. M. Waßerroth
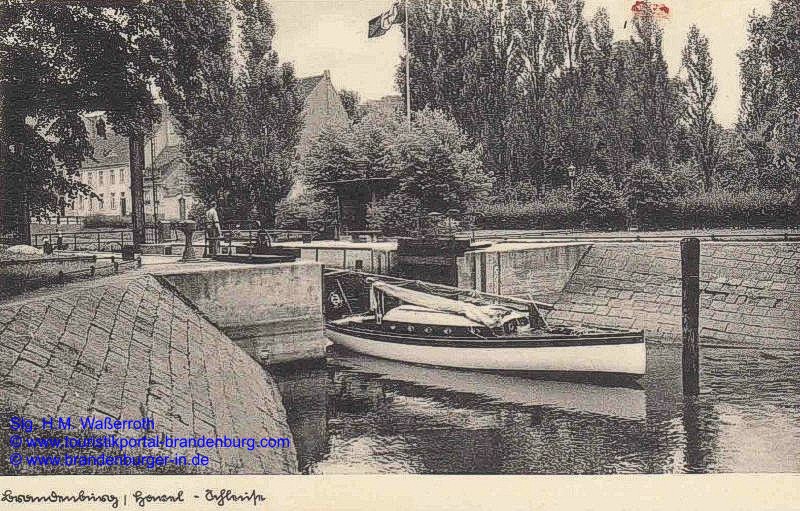
Verlag: unbekannt, Foto: unbekannt
Die Stadtschleuse auf einer
1935 gelaufenen Postkarte, Slg. H. M. Waßerroth
Im Zusammenhang mit der Errichtung des
Mühlendammes von der Neustadt, mit Einbindung der Dominsel
und zweier kleinerer Inseln, bis zum damaligen Slawendorf
Cracow entstand wohl auch der heutige Grillendamm. 1216
wurde eine "Neue Brücke" im Zuge des "Alten Dammes" erstmals
urkundlich erwähnt. Sie soll eine ältere vom Parduin zur
Burg (Dominsel) ersetzt haben und ermöglichte nun einen direkten
Zugang zum Fernhandelsweg von der Neustadt Brandenburg nach
Spandau.
Ein weiterer Damm als Verkehrsbauwerk sei
hier am Rande ebenfalls mit erwähnt: Der Sankt-Annen-Damm.
Viele werden wahrscheinlich gar nicht wissen, wo dieser Damm
denn ist, obwohl sie vielleicht vor Jahren oft darüber
gefahren sind. Bis zum Bau der Brücke über den Ostkopf des
Brandenburger Güterbahnhofes rollte der ganze Verkehr über
die heute als alte Potsdamer Straße bezeichnete ehemalige
Fernverkehrsstraße. Die Anlage dieser ca. 1,5 km langen
Trasse geht bis in Zeiten von vor 1631 zurück. Seinen Anfang
nahm er vom St.-Annen-Tor und überquert das Breite Bruch in
östlich und südöstlicher Richtung. Der Fahrdamm
verläuft über mehrere kleinere Sandinseln, bis er bei
Neuschmerzke wieder festes Land erreicht. Charakteristisch
ist die gewundene Führung des Weges, der mit dem geringsten
Bauaufwand die wegsamen Inseln verbindet.

Auf dem Sankt-Annen-Damm, ehemalige
Fernverkehrsstraße 1, heutige Alte Potsdamer Straße, ©
H. M. Waßerroth
All diese Anlagen waren auf einen
größtmöglichen Nutzen ausgerichtet, dienten der Verbesserung
der Verkehrsinfrastruktur und der optimalen Verwertung der
natürlichen Wasserkraft. Ob Schiffer, Fischer, Müller oder
Landwirte, alle hatten nur ihre eigenen Ziele vor Augen.
Deshalb kam es auch regelmäßig zu Beschwerden und
Auseinandersetzungen zwischen den einzelnen Interessen über
ein Stauziel.
Im Flussgebiet der unteren Havel hatten im Laufe der Zeit
ungünstige örtliche (topographische)Verhältnisse, Einwirkungen, die
zugunsten Landeskultur und vor allem der Volkswirtschaft von den Landesherren
in früheren Zeiten vorgenommen waren, Eigenmächtigkeiten von Beteiligten
und Anlieger und schließlich auch die zunehmende Schifffahrt von Hamburg
und Magdeburg nach Berlin in ihrem Zusammenwirken Zustände entstehen lassen,
die die Vorflut des Flusses immer mehr und mehr nachteilig beeinflussten. Die
Abführung des Frühjahrshochwassers verzögerte sich oft auf Grund der mangelnden
Abflusskapazität der Staustufe Brandenburg bis lange in den Sommer hinein.
Wasserbauliche Maßnahmen wie der Bau einer hölzernen Freiarche (Stimmingsarche)
mit Abflussgraben zum Beetzsee 1782 zur "Beschleunigung des Wasserabflusses bei
Brandenburg" und der im gleichen Zeitraum angelegte ca. 7,5 m breite
Silograben zwischen dem Beetzsee und dem Quenzsee verbesserten die Situation nicht.
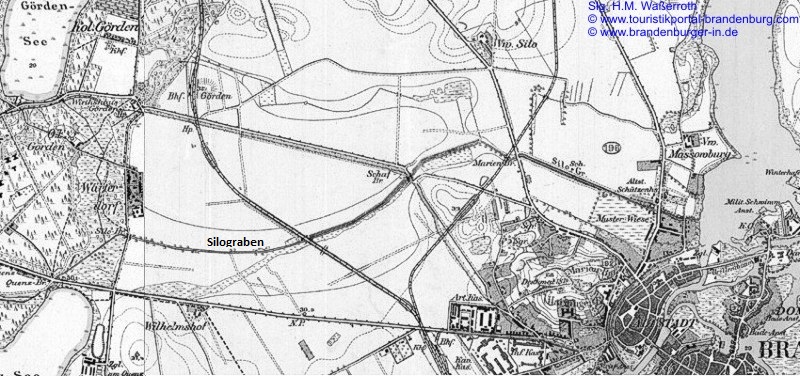
Der
Silograben auf einem Messtischblatt, Ausgabe 1903,
Brandenburgische Städtebahn und Westhavelländische Kreisbahn
wurden eingebessert, Slg. H. M. Waßerroth
Mit dem Stauregulativ vom 05.09.1832 und
einem Nachtrag dazu vom 13.12.1856 wurde für die Staustufe Brandenburg
nach zähen Verhandlungen ein Pegelstand von + 2,20 m im Winterzeitraum
und + 1,99 m für die restliche Zeit im Oberwasser am Brandenburger Pegel
festgelegt. Sobald diese Wasserstände in den entsprechenden Zeiträumen
überschritten wurden, waren sämtliche Freiarchen und Mühlengerinne so
lange geöffnet zu halten, bis das Oberwasser wieder auf das Stauziel
abgesenkt war. Auf das Steigen des Unterwassers sollte dabei keine
Rücksicht genommen werden. Damit war das Problem der mangelnden
Abflusskapazität trotzdem nicht gelöst.
Andere Regulierungsmaßnahmen wie
Durchstiche (1880) dienten vornehmlich der Verbesserung der
Schifffahrtsbedingungen. Diese fast alljährlich erfolgten Meliorationen, Vorflutverbesserungen
und Baggerungen usw. waren
nur sich auf einzelne Teile des Flusses erstreckende Maßnahmen und
erzielten nie mehr als rein örtliche und vorübergehende Erfolge.

Foto: unbekannt
Die hölzerne Stimmingsarche
in der Krakauer Straße 1905, Slg. H. M. Waßerroth

Foto: unbekannt
Blick
zum Dom, rechts die Anlagen der alten Stimmingsarche
in der Krakauer Straße vor 1909, Slg. H. M. Waßerroth
Die Wiesenwirtschaft der 5700 ha umfassenden Havelniederung
oberhalb Brandenburgs, die gerade auf zeitige Entfernung des
Winterwassers von den Ländereien angewiesen war, wurde nach und nach
an den Rand des Verderbens gebracht. Hinzu kam der stetig steigende Schiffsverkehr.
Die Kesselschleuse war um 1870 an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit gekommen.
Außerdem passte der sogenannte Plauermaß-Kahn wegen zu geringer Torweite (7 Meter)
nicht hinein. Deshalb wurde in einem Durchstich von der Brandenburger
Oberhavel zum Beetzsee von 1881 bis 1883 in der Krakauer Vorstadt die
neue Vorstadtschleuse gebaut. Mit einer nutzbaren Kammerlänge von 67 Metern
und einer Kammerbreite von 16,60 Meter bei einer Torweite von 8,40 Meter genügte
sie den neuesten Erfordernissen. Schleppzüge mit großen Kähnen nutzten nach
Inbetriebnahme die neue Vorstadtschleuse. Der restliche Schiffsverkehr fuhr
weiterhin durch die alte Kesselschleuse. Um 1890 nutzten bereits die Hälfte
aller Schiffe die Vorstadtschleuse.

Verlag: Panorama, Foto: unbekannt
Situation auf dem Stadtkanal auf
einer 1910 gelaufenen Postkarte, es herrschte eine
gefährliche Enge, Slg. H. M. Waßerroth
Infolgedessen kam man immer mehr zu der Erkenntnis, dass
diesen großen Missständen an der Havel nur dann abzuhelfen sei, wenn eine
gründliche und von einheitlichen Gesichtspunkten ausgehende Umgestaltung der
gesamten Abflussverhältnisse vorgenommen werde. Den Anfang zur Verwirklichung
dieser großen Aufgabe brachte nach langjährigen Vorarbeiten, Verhandlungen
und Entwurfsvorlagen das Gesetz vom 04.08.1904, in dem der preußische Staat
und Beteiligte Mittel zum Ausbau der unteren Havel für die Verbesserung ihrer
Vorflut in Höhe von insgesamt 11,39 Mio. Mark zur Verfügung stellten.
Alle hiernach angeordneten Bauausführungen wurden unter der Bezeichnung
"die
Verbesserung der Vorflut- und Schifffahrtverhältnisse in der unteren Havel"
zusammengefasst und einer besonderen Bauleitung unter dem Regierungs- und Baurat
Holmgreen in Rathenow übertragen. Von den im Rahmen dieses Planes ausgeführten
Bauanlagen bildeten die Arbeiten bei Brandenburg an der Havel ein in sich
abgeschlossenes Ganzes.
Berechnungen hatten ergeben, dass alle
Mühlengerinne und Freiarchen zusammen genommen eine
durchschnittliche Abflusskapazität von 140 bis 160 m3
je Sekunde haben, aber bei Hochwasser eine Kapazität von 210
bis 220 m3 je Sekunde benötigt wird. Um eine
möglichst schnelle
Gewährleistung der geforderten Stauhöhe von
+ 1,99 bis + 2,20 Meter in der Oberhavel am Brandenburger Pegel
nach Überschreiten dieses Wertes bei Hochwasser zu
garantieren, musste also die Leistungsfähigkeit der
Abflussöffnungen vergrößert werden. Eine solche Erweiterung
war nur an der im Jahre 1782 unter Friedrich dem Großen
angelegten Stimmingsarche möglich. Ihre 3 Öffnungen von je
1,68 m Weite und die Lage des Fachbaumes auf + 1,30 m des
Brandenburger Pegels waren völlig unzureichend. So entstand
für die alte Stimmingsarche in den Jahren 1909 (Wehr,
Straßenbrücke und westliche Uferbefestigung) bis 1910
(Sturzbett und östliche Uferbefestigung) für insgesamt 135000 Mark ein Ersatzneubau.
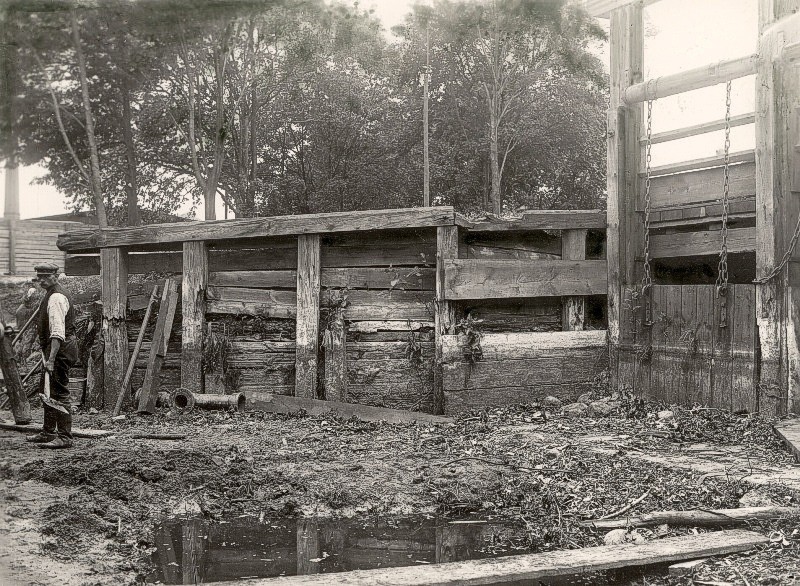
Beginn des Umbaus der alten Stimmingsarche von 1782
in der Krakauer Straße, Foto von 1909,
Slg. Stadtmuseum Brandenburg

Beginn des Umbaus der alten Stimmingsarche von 1782
in der Krakauer Straße, Foto von 1909,
Slg. Stadtmuseum Brandenburg
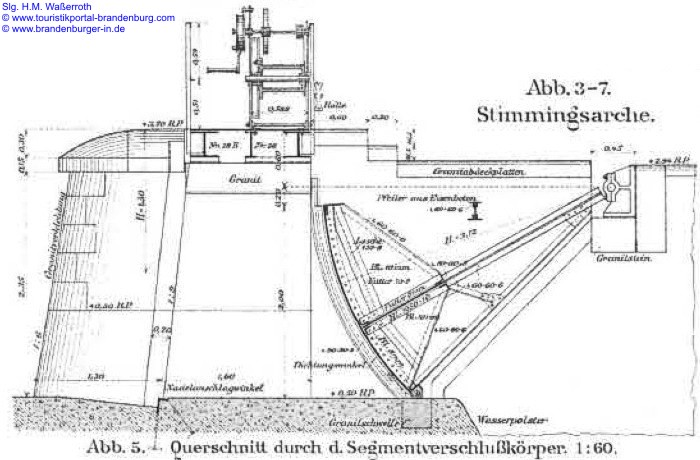
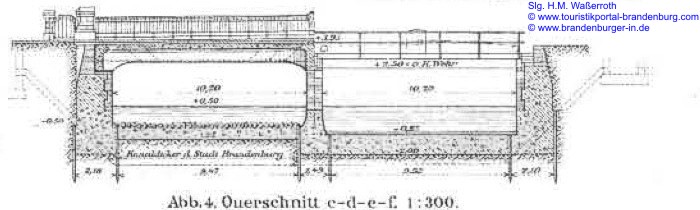
Bauzeichnungen der neuen massiven Stimmingsarche
in der Krakauer Straße, Slg. H. M. Waßerroth
Die nun massive Ausführung hatte
zwei Durchflussöffnungen von je 10 m lichter Weite. Die
Sohlentiefe lag bei + 0,50 m des Brandenburger Pegels. Die
Bedienung erfolgte von Hand über Kurbeln.
Für
die Durchflussmenge von nun bis zu 70 m3 in der
Sekunde in Spitzenzeiten mussten auch die Zu- und
Abflusskanäle entsprechend erweitert werden. Die Herstellung
des eigentlichen Bauwerkes mit Erd-, Ramm-, Beton und
Maurerarbeiten übernahm die Firma Liebold u. Co aus
Holzminden, Zweigniederlassung Berlin, die Lieferung und der
Einbau der Stahlschützen erfolgte von der Firma Noell u. Co.
in Würzburg. Alle übrigen Arbeiten sind von hiesigen Firmen
ausgeführt worden.
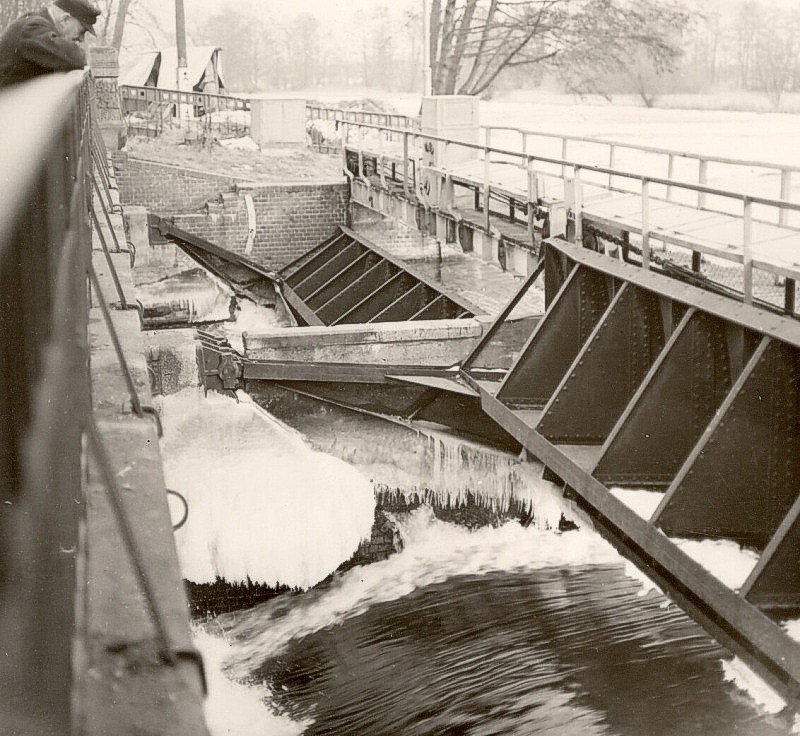
Die Schützen der neuen Stimmingsarche nach dem Umbau, Foto: Slg.
Stadtmuseum Brandenburg
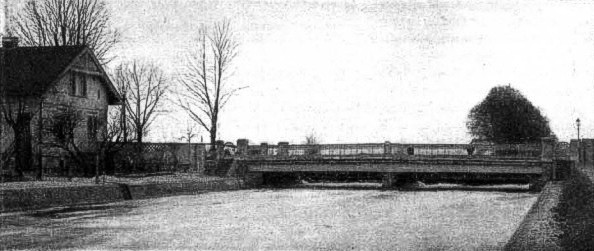
Foto: unbekannt
Die
neue Stimmingsarche
in der Krakauer Straße nach dem Umbau, Slg. H. M. Waßerroth
Die nun gewaltige Wassermenge, welche
die Stauanlagen passieren konnte, musste aber auch die
Ortslage der Stadt Brandenburg durchfließen, was ohne
Aufwendung unverhältnismäßig hoher Mittel für den
Havelausbau nicht möglich gewesen wäre. Der immer mehr
anwachsende Schiffsverkehr auf der Havel wurde in der
Ortslage durch die vielen Klappbrücken ebenfalls zum
Problem. Deshalb entschloss man sich auch aus
wirtschaftlichen Gründen zum Bau eines Kanals vom Beetzsee
durch die sogenannte Siloniederung zum Quenzsee, einem Randsee des Plauer Sees. Dieser Kanal sollte nicht nur die
Hochwassermenge ableiten, sondern gleichzeitig der
Schifffahrt die mühselige Durchfahrt durch die Stadt
Brandenburg mit ihren Brücken und Flusswindungen bis zum
Plauer See ersparen. Außerdem verkürzte sich der Weg um 2
km.
Das wiederum bedeutete, dass der
gesamte Schiffverkehr um Brandenburg herum in den Beetzsee
geleitet würde, was die Anlage einer weiteren
Schleusungsgelegenheit erforderte. Die Stadtschleuse am
Steintor würde dann nicht mehr erreicht werden. Die
vorhandene Vorstadtschleuse konnte die Schleusung der Schiffe der
Stadtschleuse aus Kapazitätsgründen aber nicht mit
übernehmen.
So entschied man sich, südlich neben
der bestehenden Vorstadtschleuse noch eine moderne
Schleppzugschleuse zu errichten.
Die Bauausführung der
Schleppzugschleuse begann im August 1906 und endete mit der
Übergabe durch den Regierungspräsidenten in Potsdam am
30.06.1909 bei einer Bereisung der Märkischen Wasserstraßen
durch die Schifffahrtkommission.
Der Bau des Silokanals begann ein Jahr
nach Baubeginn der Schleppzugschleuse im August 1907 und die
feierliche Betriebsübergabe war am 19.11.1910.
Im Laufe der weiteren Zeit erforderten
Eindeichungen an der Oberhavel und Wegfall von kleineren
Gerinnen eine weitere Erhöhung der Durchflusskapazität der
Staustufe Brandenburg auf nun 262 m3
je Sekunde. Die vollständige Öffnung der Stadtschleuse für
einen ungehinderten Wasserabfluss erreicht nur 20 m3
je Sekunde. Neujahrsarche, Eisenbahnarche und Großer
Überfall schieden für Erweiterungen aus. So wurde ein
erneuter Umbau der Stimmingsarche notwendig und von 1963 bis
1966 realisiert. In diesem Zusammenhang musste auch der
Zuflussgraben im Oberwasser im Bereich der Krakauer Havel
stellenweise um bis 40 Meter verbreitert werden. Die neue Anlage verfügt ebenfalls über 2
Durchflussöffnungen von nun 16 Meter Breite. Statt
Segmentschützen erhielt das neue Wehr Fischbauchklappen, die
je nach Bedarf abgeklappt werden können und vom Wasser
überströmt werden. In einem Häuschen auf dem Mittelpfeiler
befinden sich die Antriebe für die Klappen. Bedient werden
sie über Fernsteuerung von der nahen Vorstadtschleuse.
Die Verbreiterung der Stimmingsarche
erforderte auch einen Neubau der Straßenbrücke. Ihren Namen
hat sie im Volksmund behalten: "Brausebrücke", obwohl der
Ursprung des Namens nicht mehr gegeben ist. Als die
Stimmingsarche noch Segmentschützen hatte, "brauste" das
Wasser immer unter den angehobenen Schützen hindurch.

Der erneute Umbau der neuen Stimmingsarche, Februar 1964, Foto:
Weigelt, Slg. Stadtmuseum Brandenburg

Baustelle für die neue Stimmingsarche Februar 1964,
Foto: Weigelt, Slg. Stadtmuseum Brandenburg

Die neue Stimmingsarche kur vor ihrer Fertigstellung März 1967,
Foto: B. Wernitz, Slg. Stadtmuseum Brandenburg

Die Stimmingsarche heute, vom Unterwasser gesehen, davor
die Brücke der Krakauer Straße, ©
H. M. Waßerroth
aus verschiedenen Quellen
bearbeitet und ergänzt von H. M. Waßerroth
nach oben
Vers. 2.2.2. vom 04.01.2026
|